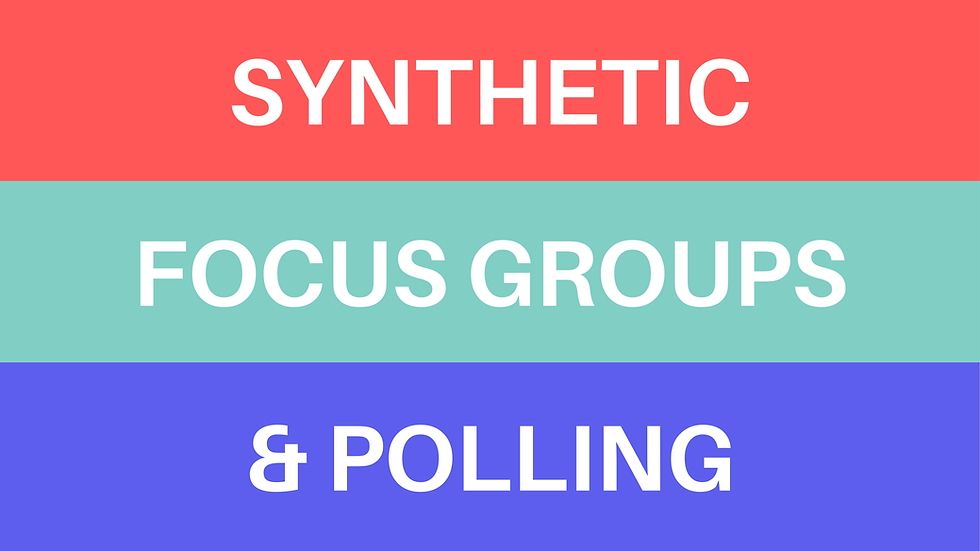Die Sechs Anforderungen an politisches Entscheiden in Zeiten von multiplen Krisen in Deutschland
- Jochen König
- 12. März 2024
- 3 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 21. März 2024

Unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Politik wird heute vor dem Hintergrund multipler Krisen herausgefordert und das politische Entscheidungshandeln befindet sich in einer absoluten Ausnahmesituation. Es geht nicht nur um eine Krise, sondern um mehrere, die gleichzeitig nahezu alle Lebensbereiche beeinflussen und eine massiv gestiegene Unsicherheit bei allen Menschen verursachen.
Die gesellschaftlichen Folgen von Corona, der Angriffskrieg auf die Ukraine, der Terrorangriff auf Israel und all die Folgen und Nebenfolgen, die sich hieraus für die Wirtschaft und Gesellschaft und damit für die politische Stimmung in Deutschland ergeben, sind massiv. Ein Großteil der aktuellen politischen Konflikte resultiert aus Krisen und deren politischer Bewältigung.
Die Bauernproteste, die harten Tarifkonflikte, Demonstrationen für die Demokratie und gegen den erstarkten Rechtsextremismus oder auch Entscheidungen wie das Heizungsgesetz. Welche Auswirkungen an dies auf das politische Entscheiden in Deutschland? Im Mittelpunkt stehen sechs Anforderungen an politische Entscheidungsträger:innen in Zeiten von multiplen Krisen
Was bedeutet politisches Entscheiden in einer Krise?
Eine Krise ist eine Situation, in welcher der Status quo durch Entscheiden, Nicht-Entscheiden oder externe Effekte grundlegend in Frage gestellt wird. Ein Weiter-so kommt nicht mehr infrage, ein Zurück ist nicht möglich, und die Frage, wie es weitergeht, lässt sich nicht mit Gewissheit beantworten. Eine Krise zwingt daher den politischen Entscheidungsträgern ein außeralltägliches Handlungsfeld auf, in welchem regelverändernde politische Entscheidungen unter der Kontingenz der Krisenereignisse, Druck, Zeitmangel und Unübersichtlichkeit an Interdependenzen getroffen werden müssen. Die Besonderheit der Politik liegt darin, dass sie als einziges Teilsystem in einer funktional differenzierten modernen Gesellschaft verbindliche Entscheidungen für andere Teilsysteme treffen kann. Daher sind politische Entscheidungen zunächst immer als Ordnungsentscheidungen zu verstehen, in denen durch politische Entscheidungen die soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche, kontingente Ordnungsstruktur einer Gesellschaft ausgebildet wird. An diese Ordnungsentscheidungen in einer Krise gibt es sechst Anforderungen:
1.Priorisierung
Politisches Entscheiden zeichnet sich zunächst durch eine Priorisierung von Sachverhalten aus, indem durch einen Akt der Wahl die Dringlichkeit der unübersichtlichen Anzahl zu entscheidende Sachverhalte hierarchisiert und strukturiert wird. Die Informationsverarbeitung und das Informationsmanagement von politischen Akteuren sind hierbei zentral. Darin liegt die erste Herausforderung: Wer entscheidet über die Dringlichkeit? Und welche Ziele spielen bei der Priorisierung eine Rolle? Dies kann reichen vom Retten von Menschenleben, Arbeitsplätzen oder auch nur dem eigenen Machterhalt. Die Dringlichkeit und damit einhergehende Priorisierung ist in den seltensten Fällen eindeutig bei Entscheidungssituationen in einer Krise. Der folgende Faktor spielt hierbei immer eine zentrale Rolle.
2.Politisierung
Jede Politisierung, hängt immer von den sach- und machtpolitischen Absichten sowie den persönlichen Profilierungszielen der Akteure ab. Daher ist politisches Entscheidungshandeln ein Instrument der Politisierung, um in Form von Policy-Präferenzen die kontingente Ordnungsstruktur einer Gesellschaft nach eigenen Wert- und Zielvorstellungen zu verändern. Dieser Veränderungsanspruch ist aber nicht immer gegeben, gerade bei multipler Krisensituationen.
3.Mehrdeutigkeit
Politische Entscheidungen sind immer von Mehrdeutigkeit geprägt. Damit ist gemeint, dass aufgrund von ideologischen Differenzen, persönlichen Interessen (Machtstreben etc.) sowie unterschiedlichen Werten und Überzeugungen divergierende Zielsetzungen und Präferenzen für Gesetze existieren.
4.Rechtfertigung
Gerade wegen der Mehrdeutigkeit müssen politische Entscheidungen immer erklärt und gerechtfertigt werden. Das ist der Kern von politischer Kommunikation. Die Begründung des Handelns dient dazu, für Akzeptanz und Unterstützung bei der eigenen politischen Basis, der Bevölkerung allgemein und den von den Entscheidungen besonders Betroffenen zu werben. Nur über Kommunikation kann politisches Handeln Legitimation erlangen.
5. Verantwortlichkeit
Jede politische Entscheidung muss in einer Demokratie nicht nur gerechtfertigt, sondern auch von einer oder mehreren Personen oder einer Partei verantwortet werden. Dabei geht es immer um ein moralisches Geradestehen. Wie schwierig dies sein kann, wird insbesondere in Krisenzeiten deutlich. Oder auch, wenn Entscheidungen getroffen werden, deren Rechtfertigung nicht ausreichend kommuniziert wird. Ein gutes Beispiel sind die Reaktionen auf das Heizungsgesetz, welches in der Verantwortlichkeit mit Robert Habeck in der Wahrnehmung verbunden wird.
6. Nebenfolgen
Das Heizungsgesetz oder auch die Kürzungen für Bauern im Zuge des Bundeshaushalts 2024 sind gute Beispiele für den Faktor „Nebenfolgen“ von politischen Entscheidungen. Bei jeder politischen Entscheidung müssen die unbeabsichtigten und meist ungewollten Folgen mitbedacht werden. Denn davon hängt oft die Akzeptanz, also wieder der Faktor der Rechtfertigung, ab. Oft werden nämlich Folgeentscheidungen als ein „Einknicken“ wahrgenommen, obwohl es sich um eine Kompensation bzw. eine Korrektur handelt.
Schlussfolgerung
Wenn man sich diese sechs zentralen Anforderungen vergegenwärtigt, wird einem beim täglichen Beobachten des politischen Geschehens schnell auffallen, wie oft diese sich mit Gesetzen, Themen und Entscheidungen verbinden lassen. Ob das Heizungsgesetz, die Kürzungen von Subventionen für Bauern oder die Debatten zu Waffenlieferungen an die Ukraine – immer sind diese sechs Anforderungen in unterschiedlichen Konstellationen von Akteuren zu erkennen. In einer Krise nehmen die Geschwindigkeit und Planungsunsicherheit massiv zu. Deswegen geht es in einer Krise immer darum, den Prozess der politischen Entscheidungsfindung so zu gestalten, dass man schnell reagieren kann und souverän mit der Unsicherheit über die Folgen sowie der Kontingenz umgeht, die einem aufgezwungen wird.
Referenzliteratur:
Besonders hervorzuheben ist der Beitrag von Friedbert W Rüb Politisches Entscheiden. Ein prozess-analytischer Versuch“, in: Bandelow, Nils C. / Hegelich, Simon (Hrsg.): Pluralismus – Strategien – Entscheidungen. Eine Festschrift für Prof. Dr. Klaus Schubert. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 17-46.: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-94169-1_2